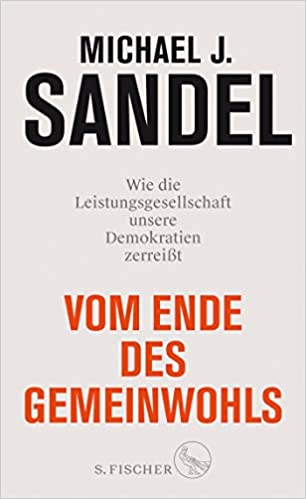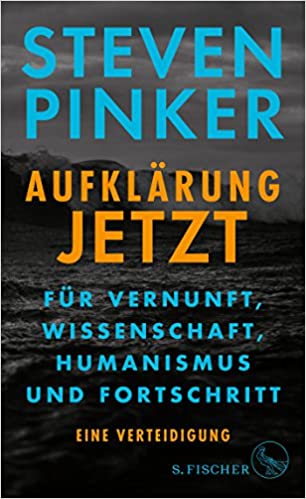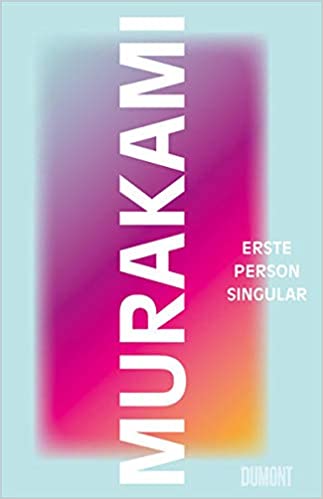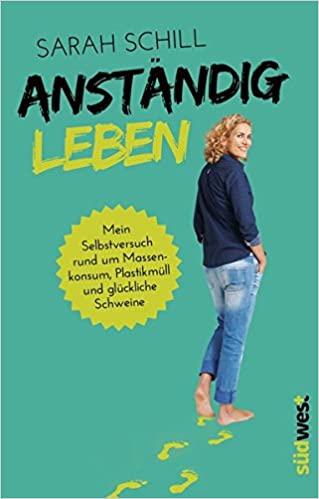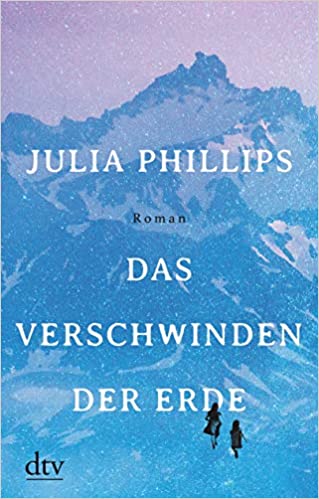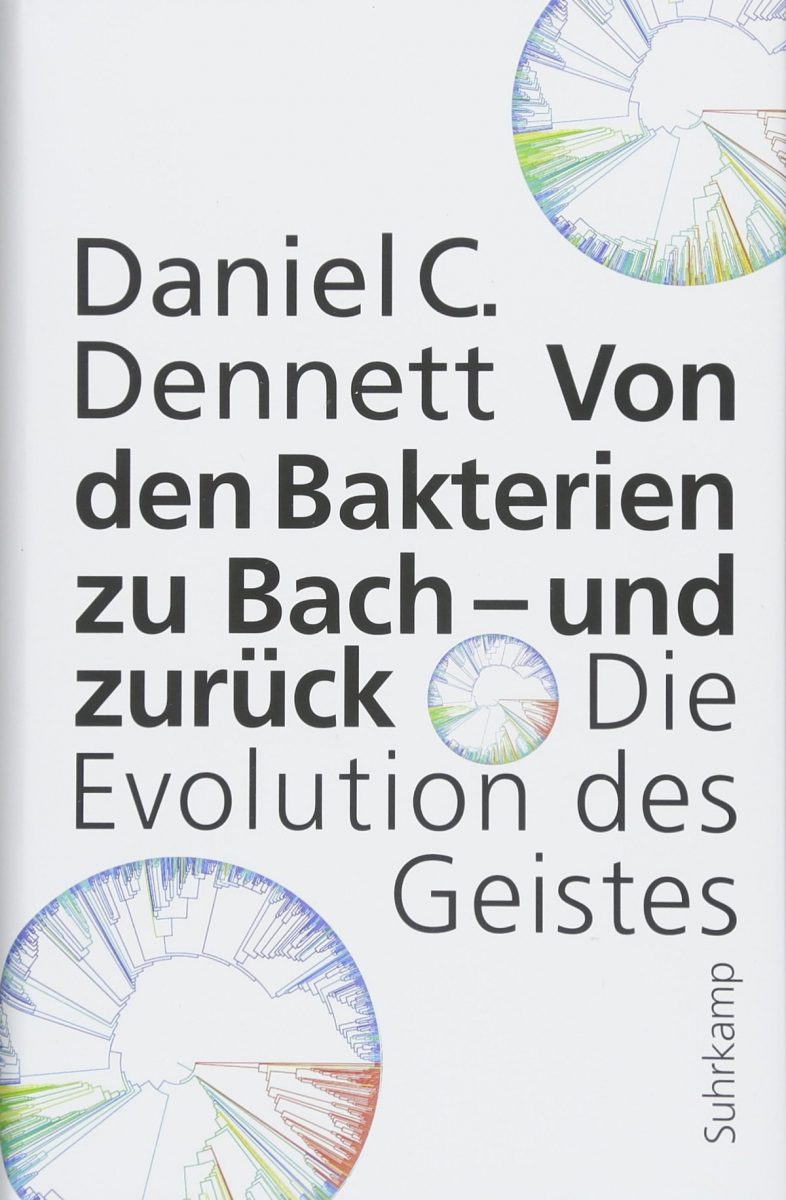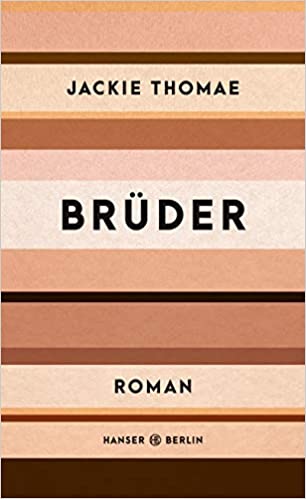
Kurz gesagt: ein anregendes Leseerlebnis!
THOMAE schreibt einen erfrischend modern wirkenden Familien- bzw. Entwicklungsroman. Eigentlich schreibt sie zwei davon, die durch eine genetische Brücke nur lose miteinander verbunden sind: Die beiden geschilderten Lebensläufe (die von Kindheit ins frühe/mittlere Erwachsenenalter reichen) sind durch einen gemeinsamen biologischen (nicht sozialen) Vater aufeinander bezogen. Der Vater hat eine schwarze Hautfarbe, die beiden Mütter sind Weiße.
Die Protagonisten sind somit Halbbrüder, die – das sei verraten – sich nie persönlich begegnet sind. Sie leben zwei völlig unterschiedliche Leben, machen extrem divergierende Erfahrungen und entwickeln sich entsprechend zu völlig verschiedenen Personen.
In gewisser Weise hat man zwei Bücher in der Hand, deren zwei Erzählstränge in weiten Teilen auch unabhängig voneinander funktionieren würden.
THOMAEs Roman lebt davon, dass sehr dichte und lebendige Einblicke in verschiedene Milieus, Lebensumstände und Beziehungskonstellationen gewährt wird.
Während Mick als alternativ-hedonistisches Mitglied der Berliner Clubszene auftritt, entwickelt sich aus Gabriel ein international tätiger Star-Architekt, der in der Londoner Wohlstands-Blase beheimatet ist.
Der gemeinsame Vater war Gast in der DDR im Rahmen der internationalen Solidarität mit Dritte-Welt Staaten. Insofern dokumentiert die Erzählung auch zeitgeschichtliche Aspekte der beiden deutschen Staaten.
In dem Leben des Architekten Gabriel wird auch seiner Partnerin/Ehefrau eine eigene Erzählperspektive eingeräumt; ein Teil der Geschichte wird als Wechselspiel aus der jeweiligen Sicht dargeboten.
Obwohl man beiden Brüdern ihre Multikulturalität ansieht, geht es in diesem Roman nicht vorrangig um Fragen oder Probleme des Rassismus. Die Herkunft ist ein Teil ihrer Identität, sie überlagert aber nicht alle anderen Aspekte – sie ist irgendwie untergemischt und tritt hin und wieder an die Oberfläche. Bestimmte Verhaltensweisen lassen sich dann als ein Kampf gegen die eigene Abstammung verstehen: so entstehen in der Abgrenzung von antizipierten Klischees neue, selbstkonstruierte Klischees.
Für mich stellt dieser Roman eine echte literarische Leistung dar; es ist eine überzeugend zeitgemäße Erzählung – inhaltlich und sprachlich. Man hat dauernd das Gefühl, dass solche facettenreichen und detailgenauen Schilderungen nur aus einer Innenperspektive her möglich sind. Es wird sehr genau hingeschaut, eingefühlt, nachgespürt. Hier leistet die Autorin bei der Innenschau ihrer männlichen “Helden” wirklich Erstaunliches.
Die beiden Welten, die sich aufspannt, bekommen sehr schnell klare Konturen; man schaut mit dem Vergrößerungsglas und ist irgendwie mitten drin.
Als jemand, dem die Lebenswelten und die gemischten Identitäten beider Brüder ziemlich fremd sind, habe ich diesen ungewöhnlich direkten und plastischen Zugang als sehr anregend genossen.
Das Ende war fast ein wenig zu “normal” für diesen besonderen Roman; aber das hat nicht gestört.