Ich glaube nicht, dass es irgendeinen gesellschaftlichen Fortschritt darstellt, wenn es jetzt heißt “KurzarbeiterInnen-Geld”.
So wie gerade in einem Einspieler bei Anne Will.

Meinungen zu Büchern und zum Tagesgeschehen
Ich glaube nicht, dass es irgendeinen gesellschaftlichen Fortschritt darstellt, wenn es jetzt heißt “KurzarbeiterInnen-Geld”.
So wie gerade in einem Einspieler bei Anne Will.
Es geht im Moment viel um „Freiheit“.
Menschen beklagen sich im Kontext von Corona über und demonstrieren gegen Einschränkungen ihrer Freiheiten: sich frei zu bewegen, überall hin zu reisen, soziale Beziehungen auszuleben oder Veranstaltungen zu besuchen. In der Öffentlichkeit und in den Medien wird engagiert darüber diskutiert, in welchem Umfang denn der „Staat“ überhaupt das Recht habe, in irgendwelche Freiheiten einzugreifen.
Man kannte diese Diskussionen zuletzt aus der Auseinandersetzung um die Klima-Krise. Auch da stellte sich für viele die Frage, ob man sich als „freier Bürger“ ein Tempo-Limit, Maßnahmen des Tierschutzes oder Beschränkungen des Luftverkehrs bieten lassen müsste.
Mit wird immer deutlicher, dass es offenbar zwei sehr unterschiedliche Sichtweisen gibt, wie die beiden Bereiche „Freiheit“ und „Staat“ zusammenhängen. Aus der jeweiligen Perspektive ergeben sich dann Schlussfolgerungen für ganz verschiedene Themenbereiche.
Die eine Variante geht davon aus, dass am Anfang die autonomen Individuen mit ihren unveräußerlichen Rechten stehen. Diese Einzelpersonen haben sich dann – aus vielen pragmatischen Gründen – in einem bestimmten Regel- und Organisationssystem zusammengeschlossen. Dabei haben sie bestimmte Rechte oder Kompetenzen auf gesellschaftliche Institutionen übertragen, also z.B. die Grundversorgung im Bereiche Bildung und Gesundheit, die Ahndung von Verbrechen oder das allgemeine Gewaltmonopol.
In dieser Sichtweise haben die Menschen dem Staat diese Rechte und Zuständigkeiten (die ihnen eigentlich weiter gehören) nur ausgeliehen. Der Staat steht also in der Verpflichtung, diese freiwillig übertragenen Aufgaben sehr zurückhaltend zu erfüllen und sollte dabei sehr aufmerksam (und misstrauisch) beobachtet werden. Bei jeder Veränderung oder Erweiterung von Regeln bedarf es demnach einer erneuten Legitimation durch den „Souverän“, den mündigen Bürger.
Der Staat ist also immer zugleich ein notwendiger Dienstleister und ein potentieller Feind, der die Freiheitsrechte bedroht.
Typischerweise wird dieses Freiheitskonzept am konsequentesten in den USA unter Trump zelebriert, in dem das Klischee vom „lonely cowboy“, der am besten ohne Staat auskommt, noch durch die Köpfe geistert.
Wie sähe ein Gegenkonzept aus?
Hier wäre der Staat (die Gesellschaft) das Primäre, die Ausgangslage. Ein Individuum wird in einen bestehenden Kontext hineingeboren. Erst dieser Kontext (Gesetze, Infrastruktur, Bildung, Gesundheitsversorgung, Polizei, Wirtschaftssystem, usw.) bietet überhaupt die Grundlage dafür, dass sich individuelle Personen entwickeln, Kompetenzen ausbilden und Erfolge erzielen können.
In diesem Modell gibt nicht der Bürger seine Macht an den Staat, sondern der bestehende gesellschaftliche Rahmen macht den Menschen erst zum Bürger, ermöglicht ihm ein relativ autonomes Leben in Frieden, Recht und Freiheit.
In einem solchen Konzept wäre es ziemlich naheliegend, wenn der Staat auf Herausforderungen und Krisen auch mit „starken“ Maßnahmen reagiert, selbst wenn diese vielleicht im Einzelfall sehr unpopulär sein sollten.
Diese Gesellschaftslogik – in dem die Gemeinschaft wichtiger erscheint als das Individuum – ist eher für bestimmte asiatische Kulturen typisch, findet sich aber ansatzweise auch in sehr fürsorglich ausgerichteten Wohlfahrtsstaaten (vor allem in Skandinavien).
Nun wird jedem denkenden Mensch klar sein, dass sich beide Modelle nicht dazu eignen, in absoluter Form umgesetzt zu werden. Wer will schon – wie in den USA – schwerbewaffnete Anti-Coronamamaßnahmen-Demonstranten oder – wie in China – eine Rundum-Überwachung in allen Lebensbereichen?!
Ich frage mich nur – und darauf will ich hinaus – ob sich nicht in der aktuellen Protesthaltung ein Freiheitsbegriff niederschlägt, der die erste Variante („der Staat ist mein potentieller Feind“) zugunsten der zweiten Sichtweise („der Staat ermöglicht mir erst all die Optionen und Freiheiten“) überbetont.
Wenn ich die Bilder von den Demos und die Aussagen einzelner Sprecher auf mich wirken lasse (die Spinner lasse ich mal weg), dann kommt es mir so vor, als ob das Regiert- und Verwaltetwerden schlechthin eine einzige Zumutung wäre. Als ob es eine Clique von macht- und geldgeilen Politiker und Wirtschaftsbossen gäbe, die sich die Welt unter den Nagel gerissen hätte. Eine Welt, die – scheinbar – ohne diese gierige und egoistische Elite in einer viel besseren Verfassung wäre, weil dann ja das Paradies der unbegrenzten Freiheit warten würde.
Wieso habe ich das unbestimmte Gefühl, dass es so ziemlich die gleichen Leute wären, die dem Staat als erstes unverzeihliche Versäumnisse vorwerfen würden, wenn durch das Unterlassen von Maßnahmen persönliche Nachteile drohen oder eintreten würden???
Ich will hier nicht einem „Durchregieren“ ohne demokratische Kontrolle und öffentliche Diskussion den Weg ebnen. Ich kann es nur schwer ertragen, wenn diese Nörgel- und Wutbürger einfach total ausblenden, auf welcher Grundlage sie denn all diese Rechte, Privilegien und Unterstützungsleistungen haben. Sie tun so, als ob sie das alles aus eigener Kraft geschaffen hätten und jetzt dieser böse Staat käme, um sie zu schädigen.
Ich möchte ihnen zurufen: „Schaut euch doch mal um in der Welt – und wenn ihr unbedingt wollt, dann macht euch auf in das Land eurer Träume!“
Ich wäre sehr gespannt, wie groß die Völkerwanderung ausfallen würde…
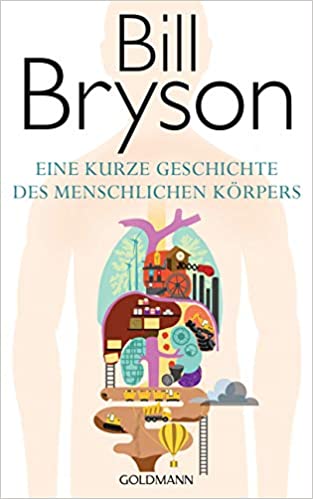
Dieses Buch habe ich gewählt, weil mich ein Vorgänger-Werk des Autors sehr beeindruckt hatte (“Eine kurze Geschichte von fast allem”). Der Journalist hat inzwischen eine kleine Reihe ähnlicher Titel publiziert.
Zum Inhalt muss man nicht viel sagen: Der menschliche Körper wird systematisch beschrieben – hinsichtlich seines Aufbaus, seiner Funktionsweise und den damit verbundenen Risiken und Krankheiten. Wie für Bryson typisch, erfährt man auch eine Menge darüber, wer unter welchen Umständen bestimmte Erkenntnisse gewonnen hat und wie sie zum Bestandteil des anerkannten Wissens geworden sind.
Interessanter ist da wohl der Stil bzw. die Didaktik.
Dass Bryson Journalist – und kein trockener Wissenschaftler – ist, spürt man fast in jeder Zeile. Der Autor bemüht sich sozusagen ununterbrochen darum, Fakten möglichst anschaulich und mit einem humoristischen Unterton zu vermitteln. Dazu benutzt er immer wieder Vergleiche bzw. Bilder, die z.B. Mengen- und Größenverhältnisse auf eine beeindruckende Art nachvollziehbar machen. Auch schildert er die manchmal allzu kleinkarierten Konflikte um den Ruhm für bestimmte Entdeckungen mit einer gewissen ironischen Zuspitzung (nach dem Motto: “Wissenschaftler sind auch nur Menschen”).
Dabei ist Bryson weder oberflächlich noch respektlos. Aber er pflegt einen “lockeren” Stil, der das Lesen (Hören) eben auch unterhaltsam und kurzweilig macht. Trotzdem ist in dem Text auch ein Staunen, manchmal auch eine fast ehrfürchtige Demut angesichts der Leistungen der “Natur” und ihrer Erforscher zu erspüren.
Bryson hat ein populärwissenschaftliches Sachbuch geschrieben, an dem es eigentlich nichts zu meckern gibt.
Die einzige Frage ist, ob man zu der passenden Zielgruppe gehört: Ein interessierter Laie mit viel Neugier bzw. Wissensdrang und einem Sinn für dezenten Humor wäre sicher der optimale Leser. Ein spezifisches Interesse für den menschlichen Körper und seine potentiellen Erkrankungen sollte man schon mitbringen – sonst ist die Informationsdichte schnell zu hoch.
Persönliche Schlussbemerkung:
Der Leser/die Leserin sollte kein Hypochonder sein! Die Konfrontation mit der Komplexität all der unzähligen und permanent aktiven biologischen Vorgänge lassen zwischendurch immer mal wieder den Gedanken entstehen, dass diese Prozesse ja nicht wirklich “in Echt” dauerhaft funktionieren können. So habe ich mich beim Hören wiederholt gewundert, dass ich am Ende des Kapitels tatsächlich immer noch lebe…
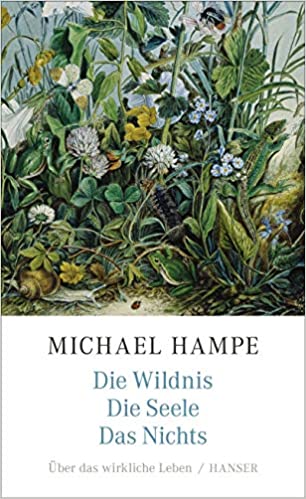
Philosophie kann eine ganz schön trockene Angelegenheit sein. Zum Glück gibt es ja seit einiger Zeit populäre Autoren wie Precht, die sich öffentlichkeitswirksam um die Verbindung zwischen philosophischen Grundfragen und unserer Lebenswirklichkeit verdient machen.
Michael Hampe, der z.Zt. in Zürich lehrt, schlägt in diesem Buch einen Mittelweg zwischen akademischer Philosophie und populärer Vermittlung ein. Er schreibt thematisch und sprachlich anspruchsvoller (und damit für eine begrenztere Zielgruppe), verlässt aber ebenfalls die engen Grenzen des üblichen wissenschaftlichen Diskurses.
Tatsächlich ist das Spannendste an diesem Buch die Einbettung der drei Essays (s. Titel) in eine geschickt und kreativ konstruierte Rahmenhandlung: Sie erzählt von einem Autoren (Aaron), der den Nachlass seines verstorbenen Freundes (Moritz) sichtet. Als (kritischer) Philosoph hat dieser außer diesen drei Texten auch Briefe und Tagebücher hinterlassen. Aaron lebt in einer dystopischen Welt. Seine Gesellschaft besteht aus einer Künstlichen Intelligenz (KI), mit der er über die Texte von Moritz munter diskutiert – angereichert durch Archivmaterial, das die KI passgenau aus ihrem unbegrenzten Speicher holt.
Letztlich führt das dazu, dass der Autor (Hampe) seine eigenen Texte nicht nur präsentieren, sondern auch gleich noch auf einer Meta-Ebene kommentieren und einordnen kann; das gibt ihnen noch eine zusätzliche Tiefe und Differenzierung. Tolle Idee.
Nun zu den Inhalten. Die drei Aufsätze, die den Kern des Buches bilden, sind keine leichte Kost.
Bei dem Essay über die Wildnis geht es um die Frage, warum es Menschen in die unberührte Natur treibt. Es wird die Frage gestellt, ob die Konfrontation mit der archaischen und ungezähmten Natur eine andere Form des Erlebens und der Selbstfindung möglich macht als die zivilisatorische Schutz- und Komfortzone.
In dem Aufsatz über die Seele werden verschiedene philosophische Konzepte einer persönlichen oder unpersönlichen Seelen-Definition diskutiert.
Unter der Überschrift Nichts geht es um die Frage, ob es allgemeinverbindliche Konzepte zu Fragen geben kann, die sich mit dem Sinn des Daseins und dem Abwägen zwischen leidvollen Erfahrungen und persönlichen Sinngebung befassen. Bis hin zu der Frage, ob nicht „Nicht-Leben“ die bessere Variante sein könnte, um Leid zu verhindern.
Das Lesen dieses Buches vermittelt durchaus ein spezielles intellektuelles Vergnügen. Das Konzept, die Themen durch eine Rahmenhandlung aufzulockern und zu erweitern, kann als gelungen betrachtet werden. Vorgeführt wird eine besondere Form des Philosophierens, die systematische Darstellungen mit anderen Zugängen verbindet, die biografischer und erzählerischer Natur sind.
Insgesamt bleibt das Buch von Hampe ein Werk für bereits philosophie-affine Menschen und kann sicherlich nicht als niederschwelliger Einstieg in die zeitgemäße Philosophie betrachtet werden.

Wie komme ich auf so ein Buch?
Nun, auf meinem Buchportal mojoreads schaue ich immer wieder mal Empfehlungen anderer Mitglieder an; das führt dann zu ganz überraschenden Entscheidungen.
An Science-Fiktion interessieren mich keine actiongeladenen Kampfszenarien mit irgendwelchen abstrusen Super-Waffensystemen. Ich will auch keine abgedroschenen Versatzstücke aus allen möglichen Fantasy-Mythen, die einfach nur in ein Zukunfts-Setting verlagert werden. Ich brauche mich nicht ins Jahr 2380 versetzen lassen, um da mit irgendwelchen Prinzessinnen oder edlen Rittern gequält zu werden.
Was ich suche? Zwei Sachen:
Ich will entweder technische Entwicklungen, die jetzt schon erkennbar sind, konsequent – und gerne auch mit viel Fantasie – weiter gedacht bekommen. Nach dem Motto: “Wo könnte die Reise hingehen?”
Oder ich will spannende Entwürfe von zukünftigen gesellschaftlichen Formen des Zusammenlebens.
Becky Chambers liefert ganz sicher keine SF-Standard-Kost. Das ist schon mal gut!
Bei ihr liegt das Schwergewicht ganz eindeutig auf der sozialen, nicht auf der technischen Seite der Zukunftsbetrachtung. Und da hat sie doch einiges zu bieten.
Das Buch nimmt uns mit an Bord eines speziellen Raumschiffs, das dafür ausgestattet ist, Verbindungen zwischen Universen herzustellen. Dafür “bohrt” es Löcher in das Raum-Zeit-Kontinuum und überwindet so Entfernungen, die sonst völlig außerhalb jeder Vorstellung wären.
Um ganz ehrlich zu sein: Aus meiner Sicht lohnt es sich nicht besonders, sich mit den astro-physikalischen oder technischen Grundlagen der Geschichte zu befassen. Dafür sind die beschriebenen Prozesse wirklich zu abgedreht.
Kommen wir zum Kern: Es geht um die Besatzung des Raumschiffes. Sie “multi-kulturell” zu nennen, wäre eine deutliche Untertreibung. Es sind völlig unterschiedliche Spezies, die hier in einer engen Team-Situation zusammenarbeiten. Und damit sind nicht etwa leichte Abwandlungen menschlicher Rassen gemeint, sondern wirklich Aliens.
Und nicht zu vergessen: Auch eine Künstliche Intelligenz (KI) ist mit im Spiel – natürlich eine mit Empfindungsfähigkeit und Ich-Bewusstsein.
Die schriftstellerische Leistung von Chambers besteht eindeutig darin, das Zusammenleben und -arbeiten dieser “Geschöpfe” sehr alltagsnah und konkret auszugestalten.
Dabei menschelt es ziemlich stark. Das hat damit zu tun, dass Menschen die kleine Mannschaft zahlenmäßig dominieren. Zunächst entstand bei mir daher auch der Eindruck, dass alles zu sehr vermenschlicht wird; aber das hat sich im weiteren Verlauf der Story relativiert.
Es ist wirklich amüsant, wenn die Unterschiedlichkeit sozialer Regeln und Gewohnheiten der beteiligten Spezies so anschaulich beschrieben werden.
Als Botschaft kann man heraushören: Wenn es offenbar sogar möglich ist, solche grundsätzlichen Verschiedenheiten mit Toleranz zu überbrücken, wie kann es dann die Menschheit ernsthaft daran scheitern, die – im Vergleich – winzigen kulturellen Herausforderungen zu meistern?!
Alles, was mit Technik zu tun hat, wird in dem Roman eher skurril als zukunftsweisend dargestellt. Es wird geschraubt und mit Ersatzteilen vom Schrottplatz gebastelt, als ob man eine Dampfmaschine zu warten hätte und keinen hypermodernen Universen-Verbinder. Man weiß nicht genau, ob man das nun witzig oder hilflos finden soll.
Ich halte der Autorin mal zugute, dass Sie mit diesem Kontrast bewusst spielt. Insgesamt gibt es in ihrem Schreibstil viel “Augenzwinkern”: Man muss das alles nicht so ernst nehmen!
Sonst wäre es auch kaum aushalten, wenn mitten im unendlichen Raum mal eben eine Post-Drohne vorbeikommt oder man alte Bekannte wiedertrifft.
Fazit: Nette Unterhaltung, die den Gedanken einer Kooperation zwischen verschiedenen Spezies mal im lockeren Stil weiterdenkt.
Übrigens ist mir nicht bekannt, ob ich umgekehrt mit meinen Rezensionen bei anderen auch “untypische” Leseabenteuer auslöse.
Die Menschen werden scheinbar zunehmend nervös.
Das macht mich auch zunehmend nervös.
Morgen muss ich unbedingt etwas dazu schreiben…
Die industrielle Fleischproduktion ist kein besonders angenehmer oder sympathischer Wirtschaftszweig. Sie ist das krasse Gegenteil.
Wir kennen aus den letzten Jahrzehnten zahlreiche Skandale rund um Tierzucht und Fleischverarbeitung. Jeder, der mal entsprechende Dokumentationen gesehen hat, kommt schnell auf die Idee, dass das ganze System ein Skandal ist.
Im Moment deckt Corona gerade mal auf, wie himmelschreiend miserabel die Arbeits- und Lebensverhältnisse der Menschen sind, die für uns in den Schlachthöfen die Sorte von Arbeit macht, die wir am liebsten gar nicht kennen würden (geschweige denn selbst tun).
Wie lange nehmen wir das alles in kauf, damit man die XXL-Grillschale im Supermarkt für 7,99 € kaufen kann?
Ich will Fleischkonsum nicht verbieten. Aber es muss schluss sein mit der Ekel-Industrie! Fleisch muss mindestens zwei- oder dreimal so teuer sein, damit es angemessen (artgerecht) “produziert” und verarbeitet werden kann.
Dann kann man auch richtige Löhne zahlen und menschenwürdige Unterkünfte anbieten.
So einfach ist das!
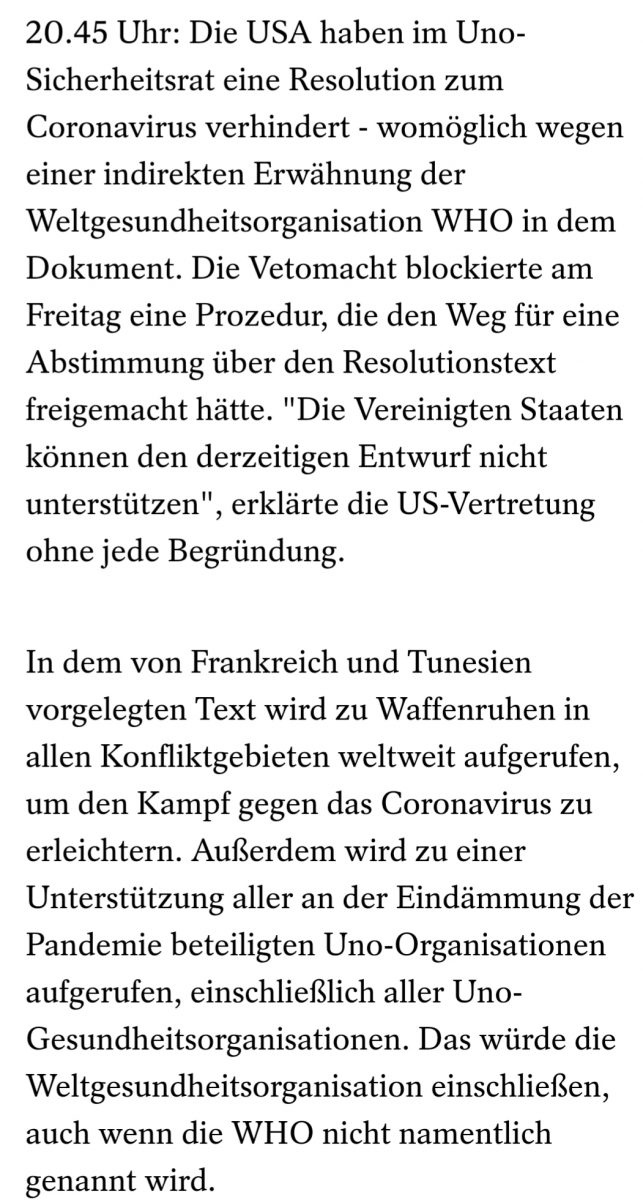
Unfassbar!
Es lohnte sich heute wieder einmal, das heute-journal anzusehen.
Der 75. Jahrestag des Endes des 2. Weltkrieges wurde in angemessener Form gewürdigt.
Ich schätze unsere öffentlich-rechtlichen Medien. Ich würde sie gerne auch den Amerikanern anbieten.
Um ehrlich zu sein: Am liebsten würde ich sie ihnen verordnen!
Ich lungere noch gemütlich im Bett herum und studiere meine “Morgen-Zeitung”, also ZEIT- und SPIEGEL-online. Dabei stoße ich auf einen Artikel, der ein wenig die Perspektive erweitert und gleichzeitig die Auseinandersetzung um Lockerungsstufen relativiert.
Es geht vor allem um die indirekten Folgeerscheinungen der Corona-Pandemie auf die Prävention und Behandlung von bekannten “Killer-Krankheiten” (Malaria, Tuberkulose, Masern) in anderen Teilen der Welt. Das liest sich absolut dramatisch und bedrohlich.
Was fängt man an mit der Hilflosigkeit, die solche Informationen auslösen? Macht es überhaupt Sinn, sich dieser zusätzlichen emotionalen Beunruhigung auszusetzen – wo wir uns doch selbst noch in einer ganz nahen Ausnahmesituation befinden? Wie viel Kapazität haben wir zum Verarbeiten, Mitfühlen oder Verdrängen?
Ich habe keine echte Antwort. Ich weiß nur, dass zwei Extreme ausscheiden sollten: Weder können wir mit ungebremster Empathie auf jede Notlage irgendwo auf der Welt reagieren, noch dürfen wir uns in völliger Ignoranz von allem abwenden, was uns nicht unmittelbar betrifft.
Meine Minimallösung ist oft folgende: Ich mache mir bewusst, wie unfassbar gut es uns hier in diesem Lande geht. Und ich versuche hin und wieder in privaten Gesprächen andere davon zu überzeugen, dass es eine globale Verantwortung für die Lebensverhältnisse auf unserem Planeten gibt.
Das ist erschreckend wenig. Ich habe riesigen Respekt vor den vielen Menschen, die mehr tun.
Und – obwohl ein unangenehmes Gefühl zurückbleibt – werde ich weiter die Katastrophen-Meldungen aus aller Welt lesen…