24.04.2024 Roll-Back bei der Landwirtschaftspolitik

Heute ist die jahrzehntelange Arbeit für eine schrittweise Umsteuerung in der europäischen Landwirtschaft beerdigt worden.
Mit ihren militanten Protesten haben es Landwirte aus verschiedenen Ländern geschafft, die mühsam erreichten und erst jüngst beschlossenen Kompromisse zurückzudrehen.
Die Versuche, erste ökologische Kriterien in den hochsubventionierten Agrarbereich einzuführen, waren sowieso nur eher zaghafte Ansätze. Sie zielten darauf, kleine Fortschritte in Richtung Ökologie und Artenschutz zu implementieren. Sie bezogen sich z.B. auf die Erhaltung kleiner Biotope auf einem winzigen Bruchteil der Anbauflächen.
Die Bauernlobby und die sie unterstützenden konservativen Kräfte haben es geschafft, die mühsam ausgehandelten Kompromisse als unzumutbare Bevormundung und Regelungswut ideologischer Bürokraten hinzustellen.
Es ist ein Armutszeugnis, dass sich auch unser grüner Landwirtschaftsminister dieser Stimmung nicht offensiv entgegenstellt und die einseitige Darstellung im Sinne von “unzumutbaren Auflagen” weitgehend unwidersprochen bleibt. Man unterwirft sich so dem allgemeinen Trend, in dem Klima- und Umweltschutz zu einem Verliererthema gemacht wird – so, als ob man sich für all das schämen müsste, was man bisher erreichen wollte.
Ein schlechter Tag für die Nachhaltigkeit – und damit auch für unsere wirtschaftliche Zukunft!
23.04.2024 Maximilian Krah bei Thilo Jung
Ich habe heute tatsächlich 6,5 (!) Stunden darauf verwandt, einem Gespräch mit dem europäischen Spitzenkandidaten der AfD zuzuhören. Es handelt sich um Maximilian Krah, der in den letzten Wochen einige Schlagzeilen gemacht hat, und der insbesondere auf YouTube bekannt für seine sehr provokativen Auftritte ist. Der Journalist Thilo Jung hat ihn auf seinem Kanal “JUNG und naiv” ausführlich befragt.
Warum habe ich das getan? Nun Krah ist wohl einer der intellektuell interessantesten Kräfte (Volljurist) innerhalb der AfD-Führung und es ist davon auszugehen, dass er sein politisches und rhetorisches Potenzial in den nächsten Jahren noch sehr öffentlichkeitswirksam zugunsten seiner Partei einbringen wird. Es erschien mir daher sehr interessant, einmal in Ruhe zu analysieren, wie dieser Mensch so tickt.
Entstanden ist ein sehr heterogenes Bild eines Menschen mit großen intellektuellen Kapazitäten, einem ausgeprägten Selbstbewusstsein und überdurchschnittlichen kommunikativen Fähigkeiten. Wenn dieser Mensch zuspitzt und provoziert, tut er dies aus einem strategischen Kalkül heraus – und sicher nicht, weil er seine Impulse nicht steuern kann.
Während ich ihm in seiner Argumentation in Teilbereichen von “Sex und Gender” tatsächlich gut folgen konnte (weil er sich dort an Wissenschaft und Logik hielt), erwies sich Krah insbesondere im Bereich von Klima und Nachhaltigkeit, bzgl. Europa und gegenüber Trump und Ukraine als geradezu grotesk neben der Spur.
Klar ist jedenfalls: Mit diesem rechten Vollblut-Politiker muss man auch in den nächsten Jahren rechnen. Unterschätzen sollte man ihn ganz sicher nicht.
“Woke – Psychologie eines Kulturkampfes” von Esther BOCKWYT
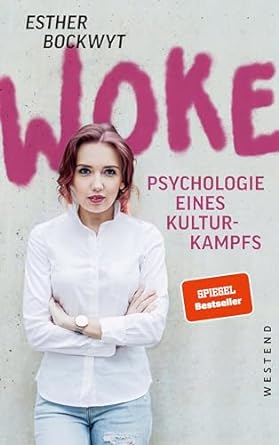
Wokeness ist nicht nur als kulturelles Phänomen im Trend, sondern hat sich inzwischen auch als Thema im aktuellen Sachbuch-Markt etabliert. Inzwischen überwiegen die kritischen Perspektiven, die oft mit massiven Warnungen vor den gesellschaftlichen Folgen eines ungebremsten Woke-Aktivismus verbunden sind.
Wenn sich eine Autorin eine psychologische Betrachtung der Wokeness-Bewegung auf die Fahnen schreibt, lässt das aufhorchen: verspricht dies doch eine zusätzliche Analyseebenen, also eine Art Meta-Perspektive auf die zugrundeliegenden Dynamiken.
Kann BOCKWYT diese Erwartung erfüllen?
Auf der quantitativen Ebene überrascht zunächst die starke Gewichtung des Darstellungs-Teils. Es wird in diesem Buch keinerlei Wissen über die verschiedenen Facetten des Gegenstandes vorausgesetzt – im Gegenteil: Ca. die Hälfte des Textes wird darauf verwendet, die Entstehung, die weltanschaulichen Grundlagen, die Einzelbereiche und die Ausdrucksformen von “Woke-Sein” ausführlich und differenziert zu beschreiben. Dabei geht die Autorin so weit ins Detail, dass man ohne Zögern von einer substanziellen Einführung in die Thematik sprechen kann; inhaltliche Fragen bleiben da – z.B. in dem extrem informativen Kapitel über Sex und Gender – nicht offen.
BOCKWYT macht keinen Versuch, den Gegenstand ihrer psychologischen Untersuchung zunächst wertungsfrei darzustellen. Vielmehr wird von Anfang an deutlich, dass die Autorin zu den Kritikern und Gegnern eines raumgreifenden Woke-Aktivismus gehört. Ihr Anliegen, den zugrundeliegenden psychischen Mechanismen auf die Spur zu kommen, findet daher nicht in einem wissenschaftlich-neutralen Kontext statt, sondern ist letztlich ein Teil des Versuches, den beobachteten Folgen und Gefahren entgegenzuwirken. Diese sieht die Autorin insbesondere in der kulturellen Spaltung der westlichen Gesellschaften, die durch eine Beschränkung von Denk- und Redefreiheit, extreme und totalitäre Tendenzen in der Bewegung und der aktiven Ausgrenzen und “Canceln” Andersdenkender entstanden ist bzw. weiter droht.
BOCHWYT weist wiederholt darauf hin, dass ihre Kritik und ihre Warnungen keineswegs den ursprünglichen, grundlegenden Zielen einer Bewegung gilt, die sich dem Kampf gegen Diskriminierung und Rassismus und für Toleranz und Vielfalt verschrieben hat.
Unterscheidet sich dieser Text bis hierhin nicht prinzipiell von ähnlichen Publikationen, kommt jetzt mit der psychologischen Analyse ein Alleinstellungsmerkmal ins Spiel. Gefragt wird: Was treibt die Wokeness-Kämpfer/innen innerlich an? Was führt vielleicht auch zu den Übertreibungen bzw. Auswüchsen in Sichtweisen und Verhalten?
Die spannendste Frage ist dabei wohl: Gibt es spezifische emotionale oder psychodynamische Muster, die man als typisch für die Persönlichkeit besonders engagierter Wokeness-Protagonisten ansehen kann – oder trifft man eher auf allgemeine Faktoren, die sich letztlich auf jede Form von radikalem Engagement anwenden ließe?
BOCKWYTs psychologische Analyse setzt sich mit den Aspekten Narzissmus (insbesondere im Sinne einer extremen Kränkbarkeit), Zwanghaftigkeit (gestrenges Über-Ich), Aggressivität (Lust an der Zerstörung), Negativverzerrung (kognitiver Fehlschluss), histrionische Begeisterung (unreife Überschwänglichkeit) und mit gruppenpsychologischen Dynamiken (Gruppendenken, Radikalisierung) auseinander.
Grundlage für ihre Betrachtungen sind dabei keine (sozial)psychologischen Forschungsbefunde, also etwa vergleichende Studien zwischen mehr oder wenigen woken Personengruppen. Vielmehr schöpft die Autorin aus einem breiten Fundus an – oft unspezifischen – Erkenntnissen und Theorien, die sie per Analogieschluss auf die woke Bewegung anwendet. Dabei reicht das Spektrum von philosophisch-soziologisch fundierten Thesen, über die Sozialpsychologie, die kognitive Verhaltenstherapie bis zur Psychoanalyse.
Das Ergebnis ist ein – aus ihrer Sicht – typisches Muster von Wahrnehmungs-, Empfindungs- und Denkstrukturen, die sich als Haltungen und Handlungen woker Menschen manifestieren. Vieles davon ist unmittelbar plausibel, manches wirkt auch ein wenig konstruiert. Anregend ist es auf jeden Fall.
Das Buch ist in einem gut verständlichen, journalistisch-orientierten Sachbuch-Stil gehalten. Es setzt keine spezifischen Fachkenntnisse, wohl aber eine Bereitschaft und Fähigkeit zur konzentrierten Themen-Fokussierung voraus.
Ohne Zweifel hat es einen Preis, dass BOCKWYTs Buch in einem insgesamt parteilich-kämpferischen Stil verfasst ist. So entsteht unvermeidlich der Eindruck, dass die wissenschaftlichen Betrachtungen so ausgewählt und gemixt wurden, wie es der inhaltlichen Mission der Autorin dient. Das macht ihre Aussagen nicht falsch oder wertlos; das Vermeiden der ein oder anderen Zuspitzung hätte aber der Glaubwürdigkeit doch gut getan.
Andererseits gibt es Stellen im Text, in denen sich BOCKWYT ganz explizit einer Überwindung von Gräben widmet – insbesondere in dem versöhnlichen Schlusskapitel.
Fassen wir zusammen:
Dieses Buch bietet zunächst eine sehr informative und breite Darstellung des Phänomens “Wokeness” – getragen von einer kritischen Grundhaltung gegenüber den (nicht bestreitbaren) Auswüchsen dieser kulturellen Bewegung. Der Versuch, zugrundeliegende Motive, Denkmuster und psychodynamische Prozesse psychologisch-wissenschaftlich zu analysieren, bietet viel Stoff für vertieftes Nachdenken und (kontroverses) Diskutieren. Allerdings handelt es sich eher um eine suchende, hypothetische Sammlung von erklärenden Facetten als um eine – oder gar die – “Psychologie eines Kulturkampfes”. Auch wenn es spannende Hinweise auf typische woke Muster gibt: Die diskutierten emotionalen und kognitiven Muster und deren Potenzierung in Dynamiken von Gruppenbildung lassen sich ganz überwiegend auf jede Gruppierung anwenden, die sich leidenschaftlich einem Thema verschrieben hat.
Als generelle Erkenntnis kommt rüber: Auch die erstrebenswertesten und edelsten Ziele (z.B. der Schutz von Minderheiten) geben Raum und Gelegenheit für das Ausagieren von menschlichen Grundbedürfnisse (wie z.B. Selbsterhöhung, Wutregulation, Aggression, Zugehörigkeit, Selbstwirksamkeit). Das gilt sowohl für gemäßigte, als auch für übersteigerte Intensitäten solcher – vom Prinzip her sinnvoller – Tendenzen.
Sich individuell und gesellschaftlich gegen maßlose Forderungen und Reglementierungen zu Wehr zu setzen – auch dazu ermutigt dieses Buch. Der stellenweise etwas kämpferische Ton wird nicht allen gefallen, schmälert aber nicht den Informationswert.
“Im Moralgefängnis” von Michael ANDRICK
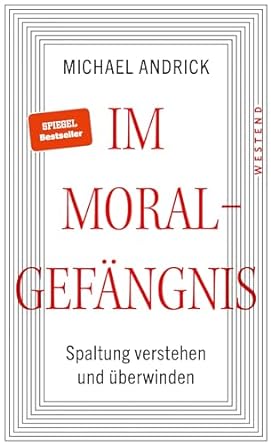
Warum – so fragt sich die interessierte Leserschaft – muss ein Autor, der für sich reklamiert, einen Beitrag zur Stärkung der Demokratie und des gesellschaftlichen Zusammenhalts leisten zu wollen, sein Buch in einer so wütenden, polemischen und durchweg zugespitzten Sprache verfassen?
Schon ein Blick auf das Buchcover markiert das Problem: Der provokante Titel steht im diametralen Gegensatz zum einladenden Untertitel; leider hat sich der Autor weitgehend für das maximale Getöse entschieden – und übertönt damit sogar die Teile seiner Ausführungen, die eine Beachtung wert wären.
Auch wenn das Überwinden der emotionalen Abneigung gegenüber dem Wutbürger-Sprachstil nicht leicht fällt, soll hier auch eine Auseinandersetzung mit dem Inhalt erfolgen.
ANDRICK sieht unsere Demokratie gefährdet – durch den Infekt “Moralisierung” des privaten und öffentlichen Diskurses; er nennt dieses Virus plakativ “Moralin”, spricht auch von “Moralin-Seuche”, “Moralin-Injektion”, “Moralitis”, “Regime des Moralismus”, “Moralitis-Epidemie”, “Wahnwelt der Fundamentalisten” usw. Zuletzt droht gar die “lebensverstümmelnde Unfreiheit”. Der Autor hat es gern sprachgewaltig…
Was meint er? ANDRICK beobachtet eine eine strukturelle Fehlentwicklung in der politischen Kommunikation, die durch folgende Aspekte gekennzeichnet sei:
– Legitime Meinungsfragen würden zu Auseinandersetzungen um (wissenschaftliche) Wahrheit vs. Lüge bzw. Gut vs. Böse umgedeutet; Sachfragen würden zu Gesinnungsfragen gemacht.
– Die Vertreter der vermeintlich unmoralischen (falschen) Position würden persönlich verunglimpft (Wechsel vom Inhalt auf die persönliche Ebene) und ihnen werde das Recht auf eine gleichberechtigte Teilnahme am Ringen um den besten Weg abgesprochen (Ausgrenzung).
– Es entstehe eine gesellschaftliche Stimmung der Kontrolle und Einschränkung von Gedanken und Meinungen, an der dominante Interessensvertreter, Politik und Medien mitwirkten – bis zu einer “volkspädagogischen” Bevormundung.
– Nach und nach bilde sich so ein kollektiver Angst- und Stresspegel, der zu einem “Befürchtungsregiment” führen und sich bis hin zu einer Angstneurose steigern könnte.
Ohne Zweifel spricht der Autor hier Prozesse und Dynamiken an, die eine soziologische und sozialpsychologische Betrachtung verdienen würde. Insbesondere in der “wokeness”-Bewegung und der darauf beruhenden “cancel-culture” lassen sich entsprechende Anhaltspunkte finden.
Das Problem ist nur: Sobald ANDRICK konkret wird, verliert er das “rechte Maß” (nicht im politischen Sinne) und lässt erkennen, dass seine Analysen auf Bewertungsmustern beruhen, die außerhalb einer Blase von Corona-Leugnern und Lügenpresse-Beschwörern wohl nur schwer zu vermitteln sind. Speziell die staatlichen Anstrengungen, angemessen auf die (neue und unzweifelhaft bedrohliche) Pandemie zu reagieren, haben den Autor offensichtlich geradezu traumatisiert: Statt reale Fehler und deren Ursachen zu untersuchen, versteigt sich ANDRICK auf die These, dass sich im “Corona-Regiment” eine “totalitäre” Politik gezeigt hätte, mit “gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit gegen Ungeimpften”. Bei dem erspürten vermeintlich “denunziatorischen Verfolgungsgeist” darf natürlich dir Verweis auf die entsprechenden Vorgänge in der NS-Zeit nicht fehlen…
Kann man, soll man, darf man das noch ernst nehmen?
ANDRICK setzt sich auch skeptisch mit der Frage auseinander, ob es überhaupt legitim sei, sich auf Wahrheit, Fakten oder Wissenschaft zu beziehen. Dabei stellt er den Sinn von “Faktenchecks” eindeutig in Frage: diese seien kaum als unabhängige Instanzen zu betrachten und oft sei auch die Frage, ob es objektive Fakten gäbe, durchaus offen.
ANDRICK missioniert in diesem Buch für den unzensierten Meinungsstreit zwischen gleichberechtigten Akteuren in einem weltanschaulich neutralen, pluralistischen Umfeld. Begrenzende Spielregeln betrachtet er mit Misstrauen: So weist er z.B. Vorwürfe zurück, bestimmte Äußerungen stellten eine “Hassrede” dar und seien deshalb unakzeptabel: dies unterstelle eine – nicht objektiv beweisbare – zugrundeliegende Gesinnung.
Dass sich ANDRICK auch an der Gender-Sprache abarbeitet, bedarf kaum der Erwähnung.
Richtig spannend wäre es gewesen, wenn man in einem Buch über Moral in der Politik eine ernsthafte Diskussion darüber gefunden hätte, welche Rolle diese denn legitimer Weise spielen könnte oder gar müsste. Zwar spricht ANDRICK kurz an, dass es auch echte Moralfragen gäbe, macht aber keine Aussagen darüber, wie denn damit zu verfahren wäre.
Es wäre sicher sehr aufschlussreich gewesen zu erfahren, ob der Autor in der Klimafrage den Hinweis auf bestehende ethisch-moralische Verantwortung auch für kommende Generationen gelten lassen würde. Wenn er das (was überraschend wäre) bejahen würde: Dürften sich dann Klimaaktivisten auf diese Moral berufen? Dürfte ein lupenreiner Egoismus in dieser Frage unmoralisch genannt werden? Welche Auswirkungen hätte das auf gesellschaftliche Bewertungen und Entscheidungen? Wäre das auch ein Beispiel für das “Moralgefängnis”?
Der Autor und sein Buch haben durchaus auch lichte Momente. Einige Betrachtungen gehen tatsächlich ein wenig in die Tiefe und ließen – in einem anderen Umfeld – durchaus produktive Diskussionen zu. Beschrieben werden das Ideal eines freien, unzensierten demokratischen Willensbildungsprozesses, das Aussteigen aus kommunikativen Spaltungsdynamiken und die Bedeutung von gegenseitigem Respekt. Positiv ist auch zu vermerken, dass zumindest erwähnt wird, dass man auch auf der konservativen Seite des politischen Spektrums nicht automatisch vor der Moralisierungs-Mechanismus gefeit ist (wenn auch nahezu alle Bespiele dem Lager der links-grünen Weltverbesserer stammen).
Insgesamt bekämpft diese Publikation eine in bestimmten Fällen durchaus kritikwürdige Tendenz zur Ausgrenzung unliebsamer Positionen mit einem untauglichen und wenig vertrauenserweckenden Mittel: mit Zuspitzung, Übertreibung und Polemik.
“Wie gesund wollen wir sein?” von Dr. Sven JUNGMANN
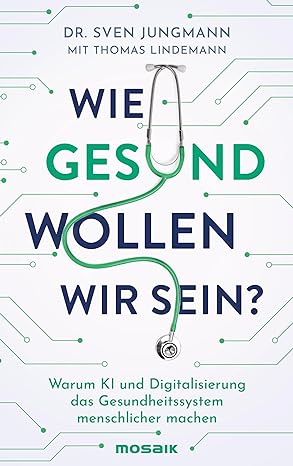
Wir haben es geahnt (oder sogar schon gewusst): Auch im Bereich Medizin/Gesundheit steht es in unserem Lande hinsichtlich der Digitalisierung bzw. des KI-Einsatzes nicht gerade zum Besten.
Der frühere Klinik-Arzt und aktuelle Medizin-Start-Upper JUNGMANN gibt uns einen informativen und praxisnahen Einblick in die Details und entwickelt Perspektiven sowohl für die nähere, als auch für die weitere Zukunft.
Der Autor holt uns bei der aktuellen Diskussion um die “Digitale Patientenakte” ab. Was in der eher verschlafenen deutschen Digital-Kultur als revolutionären Fortschritt – natürlich von zahlreichen Bedenken begleitet – diskutiert wird, stellt für JUNGMANN einen viel zu zaghaften und wenig effektiven ersten Schritt dar. Statt nämlich die Aufbereitung und Zugänglichkeit der dort gesammelten Daten nach einheitlichen Standards zu organisieren, bietet das seit Jahren umkämpfte System die Raffinesse einer “Aldi-Tüte” (in der Einzeldaten einfach nur gesammelt, keineswegs aber auch für einen Notfall nutzbar sind).
JUNGMANN greift immer wieder auf Beispiele aus dem Klinik-Alltag zurück, insbesondere auf die aufreibende Situation in der Notaufnahme. So wird uns die Ineffektivität und Rückständigkeit der Prozesse und der daran beteiligten technischen Ausstattung sehr hautnah und mit geradezu beängstigender Detailliertheit vermittelt.
Der Autor beschreibt auch ungeschminkt den Preis, den die althergebrachten Abläufe sowohl für die Patienten, als auch für das permanent überforderte medizinische Personal hat.
Seine Forderung ist glasklar: radikale Verschlankung der Routine-Aufgaben und der bürokratischen Zeitfresser durch konsequenten Einsatz von Digital- und KI-Technologien bei Datenauswertung, Diagnostik, Patienten-Basis-Information und Dokumentation.
Die eingesparte Zeit könnte dann in eine vertiefende Patienten-Kommunikation und die Beschäftigung mit speziellen Anforderungen investiert werden.
Doch JUNGMANNs Mission geht über eine Effizienzsteigerung für das System Krankenhaus weit hinaus: In seiner zukünftigen Gesundheits-Medizin geht es nur noch am Rande um die immer gleichen Standard-Therapien für die immer gleichen Volkskrankheiten.
Stattdessen sollen (und – so der Autor – werden) zukünftig
– immer mehr Daten aus der Begleitung und Überwachung unserer Vitalfunktionen einfließen (von der Fitness-Uhr bis zu neuartigen inneren Sensoren),
– auf der Basis von DNA-Analysen, eigener Krankengeschichten und Persönlichkeit mit Hilfe von KI individualisierte Therapiepläne entwickelt und
– die maßgeschneiderte Gesundheitsförderung und -prophylaxe immer stärker an die Stelle einer rein kurativen Medizin treten (was auch die Eigenverantwortung für das Gesundheitsverhalten beinhalten wird).
JUNGMANN lässt auch das leidige Thema “Datenschutz” nicht aus.
Er macht deutlich, dass ihm – bei aller Kritik an den typisch deutschen Bedenkenträgern – dieses Thema keineswegs gleichgültig ist. Allerdings sieht er keine grundsätzlichen Probleme, auch hier innovative technische Lösungen zu finden. Erste Ideen dazu trägt er vor.
Man spürt dem Autor seine innere Beteiligung an dem Thema deutlich an: Nicht nur hat das (frühere) Leiden an Stress, Frust und Überforderung Spuren hinterlassen, sondern auch die Begeisterung und das Engagement für die als notwendig erachteten Innovationen kommt rüber. Der Autor schreibt kein nüchternes Sachbuch, sondern (auch) einen persönlichen Erfahrungsbericht, einschließlich der emotionalen Aspekte.
JUNGMANN setzt sich auch mit seiner Entscheidung auseinander, sich aus dem Brennpunkt des klinischen Geschehens verabschiedet zu haben. Damit macht er auch offen, dass sein Buch auch ein wenig als Lobbyarbeit für die Produkte verstanden werden könnte, die er als Start-Up-Unternehmer in diesem Bereich entwickelt hat (und entwickeln wird). Man hat aber an keiner Stelle den Eindruck, dass dies die Glaubwürdigkeit seiner Ausführungen relativieren könnte.
JUNGMANN legt ein für ein breites Publikum gut lesbares Sachbuch zu einem extrem relevanten Thema vor. Spontan entsteht beim Lesen der Gedanke, dass möglichst alle Gesundheitspolitiker mehr als einen kurzen Blick hineinwerfen sollten.
“The Coming Wave” von Mustafa SULEYMAN
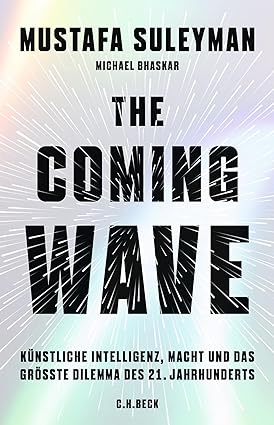
Während die Folgen des Klimawandels für die meisten Menschen eher im Zeitlupentempo zu verlaufen scheinen, ist die KI-Revolution im Expresstempo angekommen – spätestens, seit sich ChatGPT in den Büros und auf den Schülerschreibtischen breit gemacht hat.
Die Verunsicherung ist groß: Was kommt wie schnell auf uns zu? Gibt es mehr Chancen oder Risiken? Verändert sich nur unser Lernen und Arbeiten oder unser gesamtes Selbstverständnis als “Krone der Schöpfung”? Können wir überhaupt noch Einfluss nehmen?
SULEYMAN beantwortet (zusammen mit dem britischen Forscher und Publizisten BHASKAR, den ich im Folgenden nicht mehr nennen werde, weil das Buch aus der Ich-Perspektive geschrieben ist) diese und viele andere relevante Fragen. Er tut dies aus einer Position heraus, der man mit dem Begriff “Insider” nur ansatzweise gerecht wird. Der Autor steht seit über 10 Jahren im absoluten Zentrum der KI-Entwicklung: Seine eigene Firma (DeepMind) wurde 2014 von Google gekauft, er selbst hatte dort wichtige Funktionen, engagierte sich speziell im Bereich der KI-Ethik und hat aktuell einen Chefposten bei Microsoft.
Dieses Buch profitiert sehr davon, dass sich hier jemand zu Wort meldet, bei dem das KI-Expertentum bzw. das Wissen um die technischen und wirtschaftlichen Potentiale nicht zu einem Scheuklappenblick geführt haben. Eher im Gegenteil: Gerade weil der Autor alle wesentlichen Forschungs- und Anwendungsbereiche hautnah von innen kennt, legt er das Hauptgewicht seiner Botschaft auf die Beherrschung dieser Revolution.
Zunächst zieht der Autor alle Register, um selbst dem letzten Zweifler davon zu überzeugen, dass hier eine Welle (Wave) von ungeheurem Ausmaß auf uns zurollt. Besondere Aufmerksamkeit widmet SULEYMAN der Verbindung von KI und der modernen Bio-Technologie (u.a. der “Synthetischen Biologie”, also der zielgerichteten Manipulation von DNA). Aber auch für alle anderen denkbaren Anwendungsbereiche (Medizin, Robotik, Verkehr, usw.) finden sich beeindruckende Anwendungsbeispiele, die man in dieser Konkretheit sonst kaum findet.
Die Sorgen und Bedenken des Autors sind mindestens genauso ausgeprägt wie sein Respekt vor den anstehenden technologischen Umwälzungen. Dabei steht die AGI (Artificial Generell Intelligence) im Mittelpunkt seiner Überlegungen. Diesen Quantensprung zu unterschätzen hält SULEYMAN für genauso leichtfertig wie eine unkontrollierte Verbreitung von Atomwaffen.
Er verwendet einen erheblichen Teil seines Textes darauf, die Notwendigkeit und die Möglichkeiten einer Eindämmung der KI-Risiken zu diskutieren. SULEYMAN appelliert wortreich und mit spürbarer persönlicher Beteiligung für einen – wie er selbst sagt – schwierigen und schmalen Grad zwischen unkontrollierten Freiräumen für die freie Entwicklung von risikoreichen Innovationen und einer autokratischen und dystopischen Totalüberwachung. Er fordert nicht nur, sondern konzipiert entsprechende Systeme und lädt sowohl die Forschung, als auch Politik und Gesellschaft ein, daran mitzuwirken.
Das Buch richtet sich an ein breites Publikum; niemand wird durch einen technischen Spezial-Jargon überfordert. SULEYMAN formuliert eher redundant als knapp, bringt sich immer wieder mit seinen persönlichen Erfahrungen und Haltungen ein. Man spürt, dass der Autor mit diesem Buch eine Warnung, einen Weckruf, eine Mission verbindet.
Dieser Mann fürchtet tatsächlich, dass diese Welle uns überrollen könnte.
Vielleicht wird an einigen Stellen ein wenig zu detailliert auf seine persönliche Rolle in den verschiedenen Unternehmen eingegangen; nicht jede/r Leser/in interessiert sich für die Interna in bestimmten Google-Arbeitsgruppen.
Nach dem Lesen dieses Buches ist die KI-Revolution kein diffuses Schlagwort mehr. Dass diese Welle kommen wird – es werden mehrere Wellen sein – kann und wird niemand mehr bezweifeln. Dass dieses Buch zugleich informiert, aufklärt, warnt und konkrete Handlungswege aufzeigt macht es zu einem hervorragenden Sachbuch.
“Ist das euer Ernst?” von Peter HAHNE
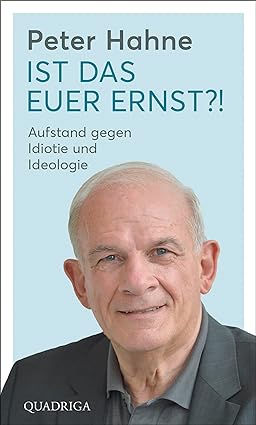
Ist das sein Ernst?
Denkt HAHNE wirklich, dass er mit diesem Text einen sinnvollen Beitrag zum gesellschaftlichen Diskurs leisten könnte?
Eine erste Frage muss man sich wohl als Rezensent vorab selber stellen: Verdient ein Autor, der sich in seiner Publikation mehrfach als Corona- und Klimawandelleugner outet (z.B.: “Da wird dann eine Grippe schon mal zur Pandemie und der jahrtausendalte Klimawandel zur aktuellen Katastrophe”) überhaupt die Mühe, die mit einer halbwegs differenzierten Bewertung seines Produktes verbunden ist?
Nun: Das Büchlein führt die aktuelle SPIEGEL-Bestseller-Liste an. Ignorieren hilft also nicht!
HAHNE widmet sich den großen Aufreger-Themen: Zuwanderung, Corona, Wokeness/Gendern, vermeintliche Fremdbestimmung im Rahmen der “verordneten” ökologischen Transformation, wirtschaftliche Probleme. Aus seiner Sicht weisen alle diese Punkte in die gleiche Richtung: auf eine politische und mediale Klasse, die idiotisch, ideologiegetrieben und unfähig ist und unser Land in Riesenschritten ins Verderben führt.
Wie geht der schreibende Wutbürger vor? Er legt eine Sammlung zahlreicher Skandälchen und Social-Media-Stürme vor, die in den letzten Jahren durch die Gazetten und Talkshows getrieben wurden. Peinliche Versprecher, gecancelte Veranstaltungen, Bespiele für Gender-Verirrungen und Fehlwirtschaft. Natürlich geht es um Zigeuner und Indianer, um Pipi Langstrumpf und die Versprecher von Baerbock,
Und dabei gibt es kein Zweifel: Ja, es gibt sie: Die Patzer, Absurditäten, Übertreibungen und Verirrungen in der sog. “Mainstream-Politik”. Es gibt das Kleinreden und Verschweigen von Fehlentwicklungen aus taktischen Erwägungen. Es gibt die voreilige und undifferenzierte Ausgrenzung von anderen Meinungen. Es gibt die Versuche, missliebige Meinungen und Personen zu canceln. Es gibt ein reflexhaftes und undifferenziertes “Gutmenschentum”, dem manchmal ein Realitätsbezug abhanden kommt. Es gibt im Bereich Feminismus, Antirassismus und Transgender Gruppen von Aktivisten, die jedes Maß verloren haben.
Die Frage ist allerdings: Welche Schlüsse lassen sich daraus ziehen und wie kann man es besser machen?
Ein HAHNEL unterscheidet nicht zwischen sinnvollen/notwendigen Zielen und Mängeln in der Umsetzung; er sieht nicht das zugrundeliegende Engagement für eine gute und alternativlose Sache (ökologische Wende), er unterstellt nicht mal eine Spur von Orientierung an Gemeinwohl und Zukunftssicherung. Das alles wäre viel zu differenziert.
Für HAHNEL sind einzig Idiotie und Ideologie die Quelle für alle Zumutungen – weil es ja für ihn die großen (unbequemen) Herausforderungen schlichtweg nicht gibt (und – siehe Coraona – nicht gab).
Interessant ist, was HAHNE auslässt: Zwar kann er Corona und den Klimawandel klein reden, doch den Ukraine-Krieg umschifft er – so, als ob er für die aktuelle wirtschaftliche und gesellschaftliche Situation unseres Landes und für die Sachzwänge der Politik keine Bedeutung hätte. So viel Ignoranz ist bemerkenswert!
Es geht ihm offenbar nicht um die Zukunftsfragen, nicht um die fortschreitende wirtschaftliche Spaltung unserer Gesellschaft, um die Beteiligung der Superreichen an der Finanzierung unseres Gemeinwesens, um die Vorbereitung auf die Verwerfungen des Arbeitsmarktes im Rahmen von Digitalisierung, Automation und KI.
Natürlich sind die Wut-Bauern seine aktuellen Helden, haben sie doch einen Kristallisationspunkt für all das diffuse Unbehagen geschaffen, das aktuelle Krisen und bevorstehende Veränderungen offenbar auslösen.
HAHNE hat einen erschreckend uninspirierenden Text geschrieben; den Mangel an Ideen und Argumenten versucht der Autor durch die schiere Sprachgewalt seiner Tiraden auszugleichen: Da ist permanent von Idiotie, geistigem Gift, Diktat, Klima-Religion, Ernährungswahn, Sprachzerstörung, moralischem Größenwahn, Öko-Sozialismus, Günstlingswirtschaft, Gehirnwäsche, galoppierendem Wahnsinn, Olympiade des Schwachsinns, Denunziantentum, totalitärem Erziehungsprogramm, versifftem Lebensstil u.ä. die Rede.
Natürlich ist auch die Löwen-Hysterie, die sich als eine banale Wild-Sauerei entpuppte, ein Beleg für das totale Politik- Staats- und Medienversagen…
Ist das der neue Sachbuch-Bestseller-Stil, mit dessen Hilfe Deutschland wieder in gesunde Bahnen kommt?
Was will HAHNE? Freiheit, Privatheit, Wohlstand – ohne lästige Konfrontation mit den Erfordernissen der multiplen Krisen . Er möchte nicht behelligt werden von den großen, globalen Herausforderungen. Er will, dass alles so bleibt wie es vorher (vor Markel und der Ampel, zumindest von 2015). Hier schreibt einer, der es offenbar mit aller Macht darauf anlegt, passgenau das Klischee vom “alten weißen Mann” zu erfüllen, gegen das halbwegs differenzierte Menschen mit viel Mühe ankämpfen.
Seine erträumte Gegenwelt findet HAHNE in der Nostalgie-Sendung “Bares für Rares”: Hier findet der Vergangenheitsfreund eine von modernen Zumutungen freie Welt mit “Herz, Hirn und Humor”. Das passt.
Dieses Buch tut nichts anderes, als sich mit Hilfe schon vielfach durchgenudelter “Skandälchen” von Wokeness und Genderwahn auf der großen Frust- und Wutwelle zu reiten. Der Beitrag von HAHNE liegt weder in einer erhellenden Analyse noch in kreativen oder zukunftsweisenden Lösungsvorschlägen – sein Beiträge sind eine erschreckend vereinfachte Zuspitzung und ein sprachlicher Extremismus, der einem schier die Sprache verschlägt. Ich kenne keine Veröffentlichung des hier so ungebremst aggressiv angegangenen politischen Lagers, die mit einer solchen Kanonade von Beschimpfungen und Beleidigungen auf die andere Seite losgeht.
Dass sich ein solcher wutschnaubender Hetzer am Ende auf Gott und das Christentum bezieht, bringt das Fass endgültig zum Überlaufen. Hier will einer ganz offensichtlich Gräben aufreißen, nicht Brücken der Verständigung bauen. Sich dafür religiösen Beistand zu vereinnahmen, ist an Dreistigkeit kaum zu übertreffen!
Was ist mit unserem Land los, dass man mit einem so niveaulosen Pamphlet ohne jeden Neuigkeitswert die Bestseller-Liste erklimmen kann?
Ist das unser Ernst?
“Im Spiegel des Kosmos” von Neil de Grasse TYSON
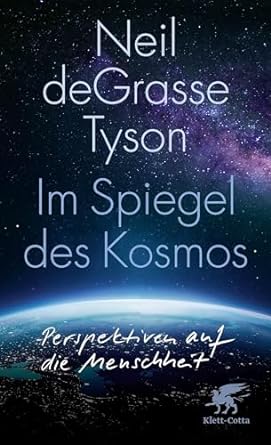
Die Kernbotschaft des amerikanischen Astrophysikers TYSON ist eindeutig und nachvollziehbar: Eine an Rationalität und Naturwissenschaft orientierte Herangehensweise an die Menschheitsprobleme ist besser als alle Alternativen geeignet, zu einer gemeinsamen Sichtweise und zu wirksamen Lösungen zu kommen.
Als Fan der Raumfahrt und der Kosmologie nutzt der Autor für die Vermittlung einen durchaus beliebten Perspektivwechsel: Die Außensicht aus dem Weltall – gerne noch personalisiert in Form von knuffigen Aliens oder einer interstellaren KI – sollte den in ihren banalen und engstirnigen Denkweisen verstrickten Erdbewohnern ihre Beschränktheit vor Augen führen und so neue Horizonte und Entscheidungsoptionen eröffnen.
TYSON traut sich was zu; es sind die großen Themen, die ihn umtreiben: Er teilt uns seine Einsichten über Krieg, Politik, Religion, Wahrheit, Schönheit, Geschlecht und Rasse mit und sieht seinen Bezugspunkt jeweils in den Methoden und Werkzeugen der Wissenschaft – und deren Output: objektive und überprüfbare Daten!
Ob dieses Sachbuch zu einem Leser oder einer Leserin passt, entscheidet sich aber wohl eher am Schreibstil als am Inhalt.
Tysons Stil ist ein eher persönlicher. Er plaudert eher, als dass er einen streng-strukturierten Argumentationslinie folgt. Er bringt sich, seine Person und seine Laufbahn, gerne ins Spiel. Überhaupt gewinnt man zunehmend den Eindruck, das hier ein von sich selbst überzeugter und vielleicht auch ein wenig selbstverliebter Autor am Werke war.
Das führt auch dazu, dass es manchmal fließende Übergänge gibt zwischen der “objektiven” Befundlage und dem individuellen Weltbild von TYSON: So irritiert zunächst der längere Exkurs in die mögliche “Empfindungsfähigkeit” von Pflanzen – bis dann klar wird, dass der Autor seine (so gar nicht wissenschaftlich zu begründende) Freude am Fleischkonsum damit rechtfertigt, dass ja auch unsere pflanzliche Ernährung vielleicht “Leid” erzeuge.
Es liest sich durchaus erfrischend, die ein oder andere Absurdität menschlicher Verhaltensweisen und Gewohnheiten durch den Spiegel einer Außenperspektive zu entlarven. Als Lesender profitiert man ohne Zweifel von dem Kaleidoskop von Einzelperspektiven, die TYSONs Suchscheinwerfer auf die Welt, ihre Schönheit und ihre Geheimnisse richten. Wir profitieren von den Erfahrungen und Erkenntnissen einer intensiv gelebten und von Erfolgen und Anerkennung gekrönten Wissenschaftler-Biografie.
Ob man mit der “Schattenseite” – einer recht üppig geratenen Selbstüberzeugtheit und einer Tendenz zum Anekdotischen – zurechtkommt, ist wohl nur individuell zu beantworten.
“Alles überall auf einmal” von Miriam MECKEL und Léa STEINACKER
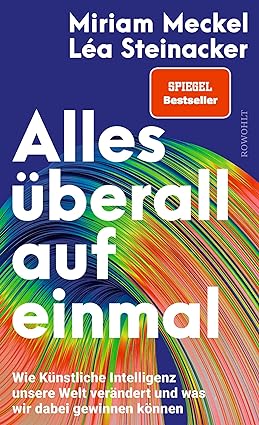
KI (Künstliche Intelligenz) ist das aktuelle Mega-Thema und ein riesiger Markt; das wirkt sich auch auf die Anzahl der Veröffentlichungen zu diesem Thema aus. Es wäre daher nicht unwahrscheinlich, wenn sich eine ganze Flut von mehr oder weniger oberflächlichen, mit heißer Nadel gestrickten und damit austauschbaren Publikationen in die Buchläden ergießen würden.
Das hier besprochenen Sachbuch spielt allerdings in einer völlig anderen Liga: Hier wird ein Standard gesetzt für die Durchdringung und Aufbereitung des Themas, an dem man sich – zumindest in der nächsten Zeit – zweifellos messen lassen muss.
Die Kommunikationswissenschaftlerin MECKEL und die Sozialwissenschaftlerin/Journalistin STEINACKER heben sich auf eine wohltuende und souveräne Art sowohl von den Technik-Enthusiasten, als auch von den Weltuntergangs-Mahnern ab. Mit einem weit gefassten Blick, jeder Menge Sachkenntnis und einem bemerkenswerten Gespür für stilistisch ansprechende Darstellung wird nicht nur umfassend informiert, sondern auch – gut begründete – Einordnungen und Bewertungen vorgenommen.
Es ist wirklich erstaunlich, dass es in einem, in diesem Buch gelingt, sowohl die Geschichte der KI zu skizzieren, die Grundmechanismen der aktuell so aufsehenerregenden “großen Sprachmodelle” zu erklären, ein Gefühl für die wirtschaftlichen Zusammenhänge und die gesellschaftliche Bedeutung zu vermitteln – und differenziert über die Notwendigkeiten und Möglichkeiten einer Regulierung der disruptiven Technologien aufzuklären.
Und irgendwie ist das alles verständlich und nachvollziehbar. Respekt!
Die Autorinnen nehmen sich Zeit für die kritischen Aspekte der KI-Revolution. Dabei geht es ihnen weniger um die Befürchtungen bzgl. einer Machtübernahme der digitalen Maschinen (einschließlich der dann offenbar anstehenden Vernichtung der Menschheit). MECKEL und STEINACKER machen deutlich, dass wir ja längst im Zeitalter der KI leben und deshalb gut beraten sind, uns mit den bereits beobachtbaren Auswirkungen zu befassen.
Auf praktischer Ebene betrifft das nicht nur – bereits sattsam diskutierten – Konsequenzen der Algorithmen unserer Social-Media-Kanäle, sondern auch die inhaltlichen Schwächen in den generierten Texten der neuen Sprachwunderwerke. Damit sind nicht nur sachliche Fehler (z.B. “Halluzinationen”) gemeint, sondern auch die “Verzerrungen” in der Darstellung, die auf eine einseitige Auswahl des Trainings-Datenmaterials zurückzuführen sind (die Welt der “weißen Männer” ist überrepräsentiert).
Dabei wäre durchaus kontrovers zu diskutieren (auch das wird angedeutet), ob man es den KI-Systemen wirklich anlasten darf (sollte), wenn sie gesellschaftliche Wirklichkeiten abbilden (statt vorgegebenen “woken” Prinzipien zu dienen).
Mit welcher Tiefe die unterschiedlichen Aspekte abgehandelt werden, mögen zwei Beispiele demonstrieren:
So machen die Autorinnen darauf aufmerksam, dass das Trainingsmaterial (das frei verfügbare Internet) durchaus endlich ist. Mittel- und langfristig ist davon auszugehen, dass die zukünftigen Systeme immer weniger hochwertiges (genuin menschengemachte) Daten vorfinden, sondern immer stärker auf bereits durch KI bearbeitete Texte zurückgreifen müssen. Hier droht ein Qualitätsverslust.
MECKEL und STEINACKER lassen es sich auch nicht nehmen, sich mit den Konsequenzen der KI-Zukunft auf das Selbstbild des Menschen zu befassen; damit bekommen die sowieso schon breit gefächerten Perspektiven noch einen philosophischen Touch.
Dieses Buch ist uneingeschränkt für alle diejenigen zu empfehlen, die mit einem soliden Rüstzeug und einem gut geeichten inneren Kompass in das Zeitalter der KI eintreten möchten. Die hier angesprochenen Themen und die ‘Art ihrer Diskussion haben durchweg grundsätzlichen Charakter und sind ganz sicher auch dann noch relevant, wenn die aktuelle Spitzen-Technologie nicht mehr GPT4 sondern GPT8 oder 10 heißt.
So etwas wie Enttäuschung könnten eigentlich nur ausgesprochene Technik-Freaks empfinden – aber die greifen ganz sicher auf andere Quellen zurück.
.
“Kapitalismus ohne Demokratie” von Quinn SLOBODIAN
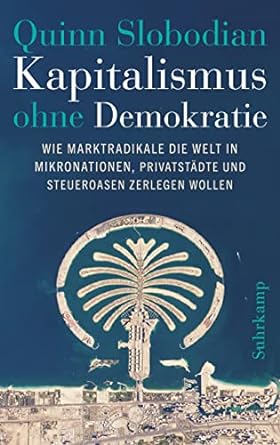
Der kanadische Historiker SLOBODIAN nimmt in diesem politischen Sachbuch eine Facette des kapitalistischen Wirtschaftsmodells unter die Lupe, die in der öffentlichen Diskussion eher im Hintergrund steht. Für die Leserschaft dieser Publikation wird sich das ganz sicher sehr grundsätzlich ändern.
Der Autor nimmt uns mit auf eine spannende Reise durch die Zeit- und Wirtschaftsgeschichte der letzten ca. 40 Jahre. Sein Navi hat eine klare Voreinstellung: Er sucht (und findet) Orte, in denen sich der Kapitalismus möglichst ungestört und ungehemmt entwickeln (man könnte auch sagen “austoben”) sollte (und meist auch konnte). SLOBODIAN schaut dabei sehr genau hin: Wenn er über Honkong, Singapur, London, Südafrika, Lichtenstein, Dubai und viele andere Sonderwirtschaftszonen und Steuerparadiese schreibt, erfahren wir viel über die beteiligten politischen Kräfte und die zugrundeliegenden Wirtschafts-Theorien und deren ideologischen Ideengeber.
Beeindruckend und überraschend ist dabei weniger die Tatsache, dass Investoren und Befürworter eines radikalen Neo-Liberalismus von bestimmten “wirtschaftsfreundlichen” Rahmenbedingungen geradezu magisch angezogen werden. Überraschend und erschreckend ist allerdings die Unverblümtheit und Selbstgewissheit, mit der das Primat der Gewinnmaximierung gegenüber allen anderen gesellschaftlichen und politischen Werten und Zielen vertreten wird.
Kenntnisreich und akribisch verfolgt der Autor die Spur der Markt-Radikalen im Unternehmertum, in der Wirtschaftswissenschaft und der (insbesondere britischen, amerikanischen und chinesischen) Politik. Er führt uns bis in die – gar nicht so kleine – Welt der “Anarcho-Kapitalisten”, die ganz offen dafür werben, nicht nur die Demokratie, sondern gleich den ganzen Staat abzuschaffen und durch private Organisationen zu ersetzen. Ein Ziel dieser Leute ist es, möglichst viele selbständige und konkurrierende (staatliche bzw. ausgegliederte) Einheiten zu schaffen, um den Einfluss gesellschaftlicher Kräfte möglichst niedrig zu halten.
Dieser Blick auf die “Urkräfte” eines ungezügelten kapitalistischen Denkens betrifft keineswegs eine kleine Schmuddelecke: Der Kampf um die Gunst der globalen Investoren führt zu einem Steuerdumping und Subventionswettlauf, der die gesamte Weltwirtschaft tangiert.
SLOBODIAN schreibt das alles in einem gut lesbaren Stil, der ohne Wirtschafts-Fachspräche auskommt. Es handelt sich um sachlichen Journalismus, ohne Effekthascherei. Zwar ist die kritische Grundhaltung des Autors nicht zu übersehen, er verzichtet aber weitgehend auf polemische Kommentierungen.
Am Ende des Buches wundert man sich (als vermeintlich halbwegs informierter Bürger), warum man mit dieser Seite des Kapitalismus so wenig konfrontiert wurde bzw. wird. Möglicherweise spielt dabei eine Rolle, dass sich unsere heimischen Konflikte in dem vergleichsweise befriedeten Umfeld der “Sozialen Marktwirtschaft” abspielen.
Dieses extrem informative Buch weitet den Blick auf die globalen Kräfte, die – ganz ohne Scham – ausschließlich die Interessen einer kleinen Elite von Superreichen verfolgen.
Gesellschaftliche Verantwortung wird dabei nicht nur relativiert, sondern rundweg abgelehnt.
Auch die Gegenkräfte werden vom Autor untersucht; auf die gelegentlichen Erfolge wird kurz hingewiesen.
Dem Buch hätte ein zusammenfassendes und einordnendes Schlusskapitel gut getan; es endet etwas abrupt. Das schmälert aber nicht den großen Informationswert. Das hier vermittelte zeitgeschichtliche Wissen hilft ganz sicher beim Verständnis und bei der Beurteilung der aktuellen wirtschaftlichen Entwicklungen und Konflikte.

