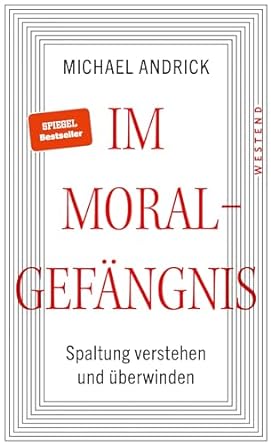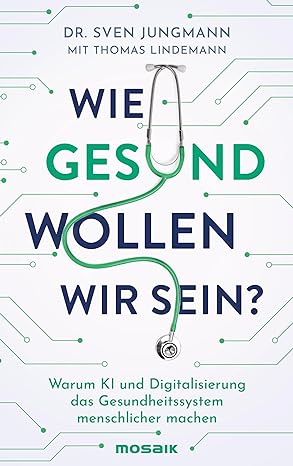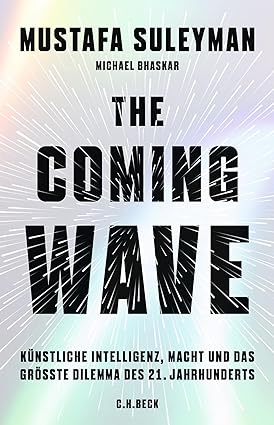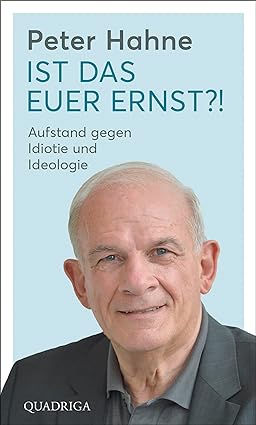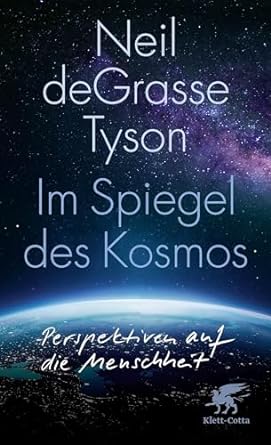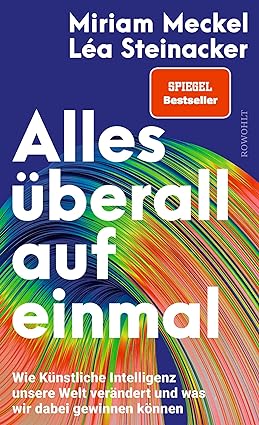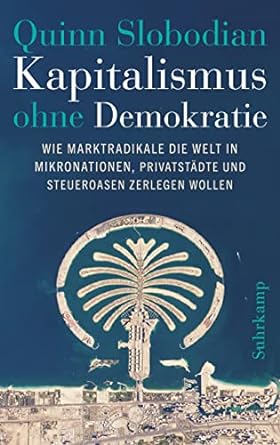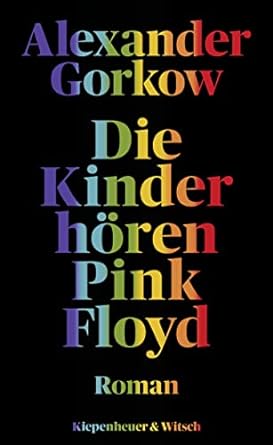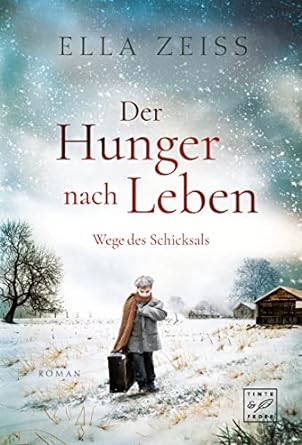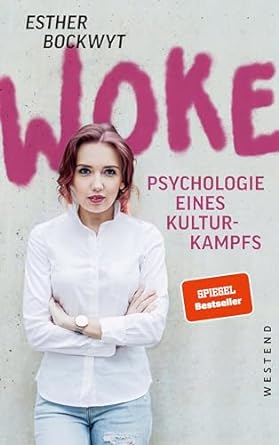
Wokeness ist nicht nur als kulturelles Phänomen im Trend, sondern hat sich inzwischen auch als Thema im aktuellen Sachbuch-Markt etabliert. Inzwischen überwiegen die kritischen Perspektiven, die oft mit massiven Warnungen vor den gesellschaftlichen Folgen eines ungebremsten Woke-Aktivismus verbunden sind.
Wenn sich eine Autorin eine psychologische Betrachtung der Wokeness-Bewegung auf die Fahnen schreibt, lässt das aufhorchen: verspricht dies doch eine zusätzliche Analyseebenen, also eine Art Meta-Perspektive auf die zugrundeliegenden Dynamiken.
Kann BOCKWYT diese Erwartung erfüllen?
Auf der quantitativen Ebene überrascht zunächst die starke Gewichtung des Darstellungs-Teils. Es wird in diesem Buch keinerlei Wissen über die verschiedenen Facetten des Gegenstandes vorausgesetzt – im Gegenteil: Ca. die Hälfte des Textes wird darauf verwendet, die Entstehung, die weltanschaulichen Grundlagen, die Einzelbereiche und die Ausdrucksformen von “Woke-Sein” ausführlich und differenziert zu beschreiben. Dabei geht die Autorin so weit ins Detail, dass man ohne Zögern von einer substanziellen Einführung in die Thematik sprechen kann; inhaltliche Fragen bleiben da – z.B. in dem extrem informativen Kapitel über Sex und Gender – nicht offen.
BOCKWYT macht keinen Versuch, den Gegenstand ihrer psychologischen Untersuchung zunächst wertungsfrei darzustellen. Vielmehr wird von Anfang an deutlich, dass die Autorin zu den Kritikern und Gegnern eines raumgreifenden Woke-Aktivismus gehört. Ihr Anliegen, den zugrundeliegenden psychischen Mechanismen auf die Spur zu kommen, findet daher nicht in einem wissenschaftlich-neutralen Kontext statt, sondern ist letztlich ein Teil des Versuches, den beobachteten Folgen und Gefahren entgegenzuwirken. Diese sieht die Autorin insbesondere in der kulturellen Spaltung der westlichen Gesellschaften, die durch eine Beschränkung von Denk- und Redefreiheit, extreme und totalitäre Tendenzen in der Bewegung und der aktiven Ausgrenzen und “Canceln” Andersdenkender entstanden ist bzw. weiter droht.
BOCHWYT weist wiederholt darauf hin, dass ihre Kritik und ihre Warnungen keineswegs den ursprünglichen, grundlegenden Zielen einer Bewegung gilt, die sich dem Kampf gegen Diskriminierung und Rassismus und für Toleranz und Vielfalt verschrieben hat.
Unterscheidet sich dieser Text bis hierhin nicht prinzipiell von ähnlichen Publikationen, kommt jetzt mit der psychologischen Analyse ein Alleinstellungsmerkmal ins Spiel. Gefragt wird: Was treibt die Wokeness-Kämpfer/innen innerlich an? Was führt vielleicht auch zu den Übertreibungen bzw. Auswüchsen in Sichtweisen und Verhalten?
Die spannendste Frage ist dabei wohl: Gibt es spezifische emotionale oder psychodynamische Muster, die man als typisch für die Persönlichkeit besonders engagierter Wokeness-Protagonisten ansehen kann – oder trifft man eher auf allgemeine Faktoren, die sich letztlich auf jede Form von radikalem Engagement anwenden ließe?
BOCKWYTs psychologische Analyse setzt sich mit den Aspekten Narzissmus (insbesondere im Sinne einer extremen Kränkbarkeit), Zwanghaftigkeit (gestrenges Über-Ich), Aggressivität (Lust an der Zerstörung), Negativverzerrung (kognitiver Fehlschluss), histrionische Begeisterung (unreife Überschwänglichkeit) und mit gruppenpsychologischen Dynamiken (Gruppendenken, Radikalisierung) auseinander.
Grundlage für ihre Betrachtungen sind dabei keine (sozial)psychologischen Forschungsbefunde, also etwa vergleichende Studien zwischen mehr oder wenigen woken Personengruppen. Vielmehr schöpft die Autorin aus einem breiten Fundus an – oft unspezifischen – Erkenntnissen und Theorien, die sie per Analogieschluss auf die woke Bewegung anwendet. Dabei reicht das Spektrum von philosophisch-soziologisch fundierten Thesen, über die Sozialpsychologie, die kognitive Verhaltenstherapie bis zur Psychoanalyse.
Das Ergebnis ist ein – aus ihrer Sicht – typisches Muster von Wahrnehmungs-, Empfindungs- und Denkstrukturen, die sich als Haltungen und Handlungen woker Menschen manifestieren. Vieles davon ist unmittelbar plausibel, manches wirkt auch ein wenig konstruiert. Anregend ist es auf jeden Fall.
Das Buch ist in einem gut verständlichen, journalistisch-orientierten Sachbuch-Stil gehalten. Es setzt keine spezifischen Fachkenntnisse, wohl aber eine Bereitschaft und Fähigkeit zur konzentrierten Themen-Fokussierung voraus.
Ohne Zweifel hat es einen Preis, dass BOCKWYTs Buch in einem insgesamt parteilich-kämpferischen Stil verfasst ist. So entsteht unvermeidlich der Eindruck, dass die wissenschaftlichen Betrachtungen so ausgewählt und gemixt wurden, wie es der inhaltlichen Mission der Autorin dient. Das macht ihre Aussagen nicht falsch oder wertlos; das Vermeiden der ein oder anderen Zuspitzung hätte aber der Glaubwürdigkeit doch gut getan.
Andererseits gibt es Stellen im Text, in denen sich BOCKWYT ganz explizit einer Überwindung von Gräben widmet – insbesondere in dem versöhnlichen Schlusskapitel.
Fassen wir zusammen:
Dieses Buch bietet zunächst eine sehr informative und breite Darstellung des Phänomens “Wokeness” – getragen von einer kritischen Grundhaltung gegenüber den (nicht bestreitbaren) Auswüchsen dieser kulturellen Bewegung. Der Versuch, zugrundeliegende Motive, Denkmuster und psychodynamische Prozesse psychologisch-wissenschaftlich zu analysieren, bietet viel Stoff für vertieftes Nachdenken und (kontroverses) Diskutieren. Allerdings handelt es sich eher um eine suchende, hypothetische Sammlung von erklärenden Facetten als um eine – oder gar die – “Psychologie eines Kulturkampfes”. Auch wenn es spannende Hinweise auf typische woke Muster gibt: Die diskutierten emotionalen und kognitiven Muster und deren Potenzierung in Dynamiken von Gruppenbildung lassen sich ganz überwiegend auf jede Gruppierung anwenden, die sich leidenschaftlich einem Thema verschrieben hat.
Als generelle Erkenntnis kommt rüber: Auch die erstrebenswertesten und edelsten Ziele (z.B. der Schutz von Minderheiten) geben Raum und Gelegenheit für das Ausagieren von menschlichen Grundbedürfnisse (wie z.B. Selbsterhöhung, Wutregulation, Aggression, Zugehörigkeit, Selbstwirksamkeit). Das gilt sowohl für gemäßigte, als auch für übersteigerte Intensitäten solcher – vom Prinzip her sinnvoller – Tendenzen.
Sich individuell und gesellschaftlich gegen maßlose Forderungen und Reglementierungen zu Wehr zu setzen – auch dazu ermutigt dieses Buch. Der stellenweise etwas kämpferische Ton wird nicht allen gefallen, schmälert aber nicht den Informationswert.